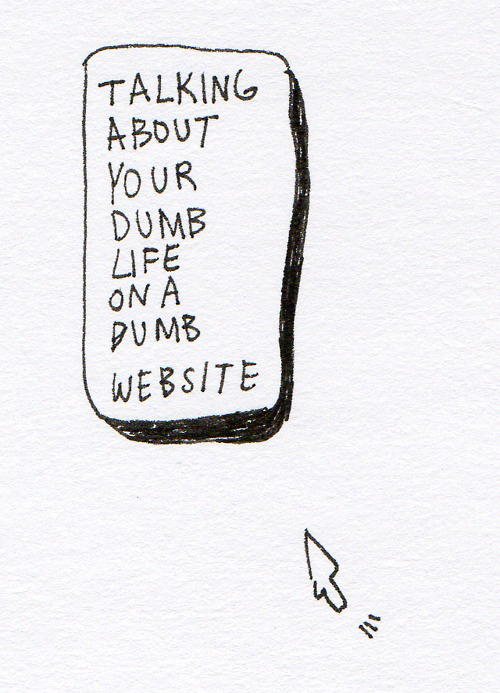Der pornographische Blick macht es leicht, Menschen unmenschlich zu behandeln, schreibt Ariadne von Schirach in „Der Tanz um die Lust“, ein Buch das, Sie ahnen´s möglicherweise bereits, meiner Meinung nach in jeden guten Haushalt gehört.
Loch, Loch, Nippel, Pimmel, Loch. Um Lust, oder sagen wir mal zumindest Sex, filmisch sichtbar zu machen, bedienen sich Mainstreampornos einer simplen Ästhetik: sie filmen einfach dort drauf, wo man´s nun mal offiziell am besten sehen kann.
Dadurch geht es nicht mehr um die Körper an sich. Oder um die Menschen, die dort Dinge miteinander anstellen. Es geht um: Loch, Loch, Nippel, Pimmel, Loch. Es geht nicht um Gefühle, und um die soll es auch gar nicht gehen. Es geht um diese bestimmte Ästhetik, die da sagt: Loch: stopfen. Es ist ein Konzept für eine Gesellschaft mit großem Abstrahierungswillen, und woher der kommt, ist verständlich: wär ja auch schließlich schön, wenn alles so einfach wär.
Divide et impera, teile und herrsche. je genauer, je feiner der Zugriff, desto besser lässt sich Einfluss nehmen. Etwas wird fragmentarisiert, aus seinem natürlichen Kontext gerissen, unangemessen beleuchtet und dadurch in Bezug zu dem gesetzt, was „normal“ ist. (von Schirach, S.197)
Es ist ein simpler Machtmechanismus, einer, wie von Schirach meint, auch dem Grundprinzip Frauenzeitschrift zugrunde liegt. Frauen werden in Problemzonen fragmentisiert, und können so besser „behandelt“ werden: hier noch etwas Koffein-Roll-On gegen die Tränensäcke, und gegen die Cellulite kann man ja inzwischen auch so viel machen!
Alles soll möglichst fickbar gemacht werden, erotisiert, optimiert. Problemzone Mensch. Und diese Problematisierung, die in einem wesentlich größeren Kontext stattfindet, machen Frauenzeitschriften und Pornos, so von Schirach, besonders deutlich sichtbar.
Wieder einmal stehen wir vor einer selbst geschaffenen Ungeheuerlichkeit zu Zeiten der Industrialisierung vor den unmenschlichen Produktionsbedingungen. Nur ist es diesmal das Leben selbst, das produziert wird.“ (…) „Damit das Leben produziert werden kann, muss es erst einmal auseinander genommen werden, aufgesplittert, sichtbar gemacht, und in jedem kleinsten Teilchen kann dann Bedeutung verliehen werden. Wahrscheinlich hat irgendwann jede Körperfunktion ihre eigene TV-Show. (Von Schirach, S.196, f.)
Und das ist tatsächlich eine der Argumentationslinien, die ich im Zusammenhang mit der ganzen Frauenzeitschriften-sind-doch-total-furchtbar-Debatte sehr klug und wichtig finde. Und ein Problem, dem ich persönlich mit meiner Arbeit, so gut es geht, entgegen wirken möchte.
Denn genau darum geht es meiner Meinung nach: Für Dinge, die man gut findet, leidenschaftlich einzutreten – und laut drüber zu reden. Und Dinge, die man verbesserungswürdig findet, besser zu machen – oder es zumindest versuchen. Und genau das war das Problem der ursprünglichen Debatte: es ging nicht um Inhalte. Um Grauzonen, Differenzierungen, oder die Frage was anders sein sollte. Es wurde nicht unterschieden zwischen Brigitte und Closer oder zwischen Maxi und InStyle. Und genauso wenig, wie es in dieser Debatte tatsächlich um die ging, die eigentlich angesprochen wurden, ging es hier in den entsprechenden Blogkommentaren darum.
Lieber Bildblog, es ist ein zweischneidiges Schwert mit dir. Klar: einerseits ist es ein riesiges Kompliment, von einem der größten deutschsprachigen Blogs als einer von 6 lesenswertesten Artikeln des Tages verlinkt zu werden. Neben Moritz von Uslar oder Sascha Lobo. Nicht als SEXautorin, sondern als Autorin, Punkt. Das ist so ähnlich, wie im Ausland ein normales Gespräch zu führen. Und nicht als erstes gefragt zu werden, wie man sich denn eigentlich hier so fühlt. Als Deutsche und so.
Andererseits tut es nicht viel für mich – außer dem Gefühl, in einer Kneipe zu stehen, meinem Gesprächspartner (in diesem Fall Chefredakteur Herbert , der den TAZ-Artikel für meinen Geschmack ein bisschen zu unreflektiert wiedergekäut hatte) irgendwas über die laute Musik hinweg zuzubrüllen, und plötzlich sind 40.000 Augenpaare auf mich gerichtet, und gar nicht mal so wenige davon schreien: „Das ist nur weil du blond bist, du dreckige Hure Satans! Lies mal „Herr der Ringe“, sonst wird das nie was!“
Und so bin ich mit einer klitzekleinen Verlinkung wahlweise zu akademisch, zu dumm, zu geisteswissenschaftlich, zu arbeitslos, zu karrieregeil, zu arrogant, zu knackig, zu überheblich – wie die Exen vom Dings – Bitch, Please!
Und an den Klicks und Interaktionen merkt man, das kaum einer der Kommentatoren, die da am Werk sind, auch nur einen einzigen anderen Artikel von mir gelesen haben kann – geschweige denn, dass sie die eigentliche Thematik (oder die Website, auf der sie sind – sich im Blog eines Erotikmagazins darüber ereifern, dass überhaupt Sex geredet werden muss? Ja.) besonders interessiert. Aber anscheinend ist das auch gar nicht so wichtig.
Denn der aufgebrachte Bildblog-Pöbel jagt gern mit brennenden Mistgabeln durchs virtuelle Dorf, und versucht angestrengt, irgendwo hinzuhacken, wo´s weh tut. Ein Scheißestürmchen der Entrüstung, das nichts, aber auch gar nichts mit den „normalen“ Lesern hier im Blog zu tun. Denn bei dem, was hier passiert, geht es kein bisschen darum, wer ich bin oder was ich mache – und die, die da kommentieren, sind meist die letzten, die das eigentliche Thema überhaupt persönlich betrifft.
Ja, es übersteigt zugegebenermaßen mein Vorstellungsvermögen, dass sich jemand tatsächlich extra eine spezielle Spam-Mailadresse mit „Feigenblatt“ im Namen zulegt, um so richtig geil anonym ins Internet kacken zu können.
Ich weiß nicht genau, wie traurig, einsam, verzweifelt oder gelangweilt jemand ist, der hobbymäßig Kommentare schreibt, die länger sind als der ursprüngliche Artikel selbst. Und mir fehlt auch ehrlich gesagt die Freizeit, es wirklich nachvollziehen zu wollen: warum Menschen versuchen, aufgrund eines Freitagmittag zwischen acht anderen Baustellen hingerotzten Disskommentars an meinen heißgeliebten Chefredakteur und einem immerhin 5 Jahre alten Thumbnailbild von mir, versuchen Rückschlüsse auf mich und mein Wesen zu ziehen, um möglichst gut zutreten zu können.
Eh klar: lovers wanna love, haters wanna hate, und Trolls trollen halt in der Gegend rum – nichtsdestoweniger ist und bleibt es ein äußerst merkwürdiges Gefühl, wenn wildfremde Menschen beginnen, an irgendeinem Teil von einem zerren zu wollen, auch wenn sie dabei so offensichtlich ins Leere greifen, dass ich stellenweise laut lachen musste – als „zu dünn und erfolgreich“ um die Probleme anderer Leute wahrzunehmen, hat mich bis jetzt komischerweise noch nie jemand bezeichnet…
So oder so zeigt es eins: Fragmentarisierung ist eine zutiefst menschliche Angewohnheit – die auch vom anonymisierten Trollpulk des Weltnetzes begeistert aufgegriffen wird. Und das, obwohl die hier kommentierenden „diese furchtbaren Frauenzeitschriften“ ja eh nie lesen würden? Hm.
Es ist ein Mechanismus, an den man sich, als – Ihgitt, Journalist! – früher oder später gewöhnen sollte. Und noch mehr, wenn man als solcher versucht, über Sex, Pornographie oder gar Intimität zu schreiben.
Einigermaßen pervers wird es nämlich, wenn die Realität beginnt, das Internet zu imitieren.
Es ist der Bekannte, der die gute Freundin fragt, ob ich „in echt“ eigentlich auch „so offenherzig“ wäre, wie´s in meinem Blog immer wirkt. Der nackte Typ im Bett neben mir, der dann angenehm überrascht ist, weil er sich das mit mir prinzipiell anders vorgestellt hatte. Abgestumpfter. „Wo du doch immer so viel über Sex schreibst, und alles.“ Es ist ein generelles „Ich sag dir jetzt mal, was eigentlich dein gottverdammtes Problem ist“ aus den Mündern Halbbekannter, das aus einem Mangel an Distanziertheit resultiert, den ich inzwischen nicht mehr allein auf mein ach-so-offenes Wesen zurückführen kann. Es ist das klassisches Kolumnistenproblem: zu denken, man würde denjenigen, der da schreibt, gut kennen.
Ich hab keine Ahnung, bei wem alles das Kopfkino angeht, wenn ich schreibe, dass „Shades of Grey“ kein authentisches BDSM ist: Jawoll, und am Wochenende peitsche ich androgyne Jungfrauen in Latexmaske quer durch mein Wohnzimmer.
Meine Reaktion darauf ist immer dieselbe, und ich schätze, das liegt daran, dass es einfach die Standardreaktion aufs Kategorisiertwerden ist: Befremden. Da steht niemand so sehr drauf. Komisch komisch.
Im privaten Umfeld sind solche Reaktionen ein einigermaßen zuverlässiger Bullshit-Indikator. Ich hab es tendenziell lieber, wenn Leute mich fragen, warum ich wie bin, anstatt es mir ungefragt zu erklären. Und das ist auch im Weltnetz nicht anders.
Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Klar macht es Spaß, mit diesem ganzen Sexkolumnistendingsdasein zu spielen und darüber Witze zu machen.
Und die unvermittelt offenen Gespräche, die mir dieser Status ermöglicht, sei es hier im Blog, auf Facebook oder auf irgendwelchen Parties in irgendwelchen Küchen oder irgendwelchen Betten, möchte ich auf keinen Fall missen. Ich hab immer viel zurückbekommen, Menschen von neuen Seiten kennen gelernt, viel gesehen, viel verstanden. Ich erlebe sehr viel Offenheit und Begeisterung für das, was ich tue.
Und dennoch bin ich froh darüber, dass die meisten von euch weder wissen, welcher Song jetzt gerade bei mir im Itunes läuft, noch, wie viele Cellulitedellen ich so am Arsch habe. Dass es Teile von mir gibt, die noch niemand fragmentarisiert hat, auch nicht ich selbst. Denn, wieder von Schirach, Fragmentarisierung bedeutet auch, dass die einzelnen Teile nicht mehr von einem übergeordneten Ganzen organisiert werden. Es kommt zu Künstlichkeit. (S.198)
Und ich kann und will nicht bei jedem Stück Text(fragment), das ich hier hinrotze, darüber nachdenken, wie viele Leute daran Anstoß nehmen (könnten/wollen), und warum. Ich kann nicht bei jedem Mal, wenn ich WordPress öffne, den Anspruch an mich selbst haben, die Weltformel zu entwickeln. Weil keiner vorhersehen kann, wann was von wie vielen (und welchen) Leuten gelesen werden wird. Und weil ich für die Weltformel dann doch tatsächlich einigermaßen unterbezahlt bin.
Ich will in einer Kneipe stehen und über die Musik hinwegschreien können.
Ansonsten kann ich mich nämlich auch gleich auf dieses Volontariat in der Pressestelle beim Amt für Denkmalpflege der Stadt Dings bewerben, und mir ab sofort nur noch auf meine Beamtengehaltsklasse einen runterholen – für Verheiratete gibt´s sogar einen Hunderter mehr, can you fucking believe it?
So oder so ist zerstückelt werden eine äußerst merkwürdige Angelegenheit. Herbert hat die Kommentarfunktion zum Zeitschriftenartikel mit der Argumentation geschlossen, dass ich mich durch „meine persönliche Betroffenheit angreifbar“ gemacht hätte. Und das stimmt, wenn auch nur zum Teil. Denn angreifbar macht mich nicht die Tatsache, dass Frauenzeitschriften mir für meine Weisheiten gutes Geld zahlen, oder was ich studiert habe, oder wie „knackig“ oder „dünn“ (haha, tschuldigung, aber: haha) ich bin.
Angreifbar macht mich, dass ich versuche, bei dem was ich schreibe, Haltung zu bewahren, und vor mir selbst und allen anderen einigermaßen aufrichtig zu sein. Mit Namen. Und Bild. Angreifbar macht mich mein Bedürfnis nach Konstruktivität. Weil Ironie immer leichter ist.



 Beim besten Willen verstehe ich die Gegner solcher Verbindungen nicht. Ist für sie die Ehe ausschließlich eine Gemeinschaft zur Produktion und Aufzucht von Kindern? Aber dann müssten kinderlose Ehen anders behandelt werden und das Eheverbot auch für Frauen ab Mitte vierzig gelten. Im übrigen haben auch manche Homosexuellen Kinder oder versuchen, welche zu bekommen.
Beim besten Willen verstehe ich die Gegner solcher Verbindungen nicht. Ist für sie die Ehe ausschließlich eine Gemeinschaft zur Produktion und Aufzucht von Kindern? Aber dann müssten kinderlose Ehen anders behandelt werden und das Eheverbot auch für Frauen ab Mitte vierzig gelten. Im übrigen haben auch manche Homosexuellen Kinder oder versuchen, welche zu bekommen.